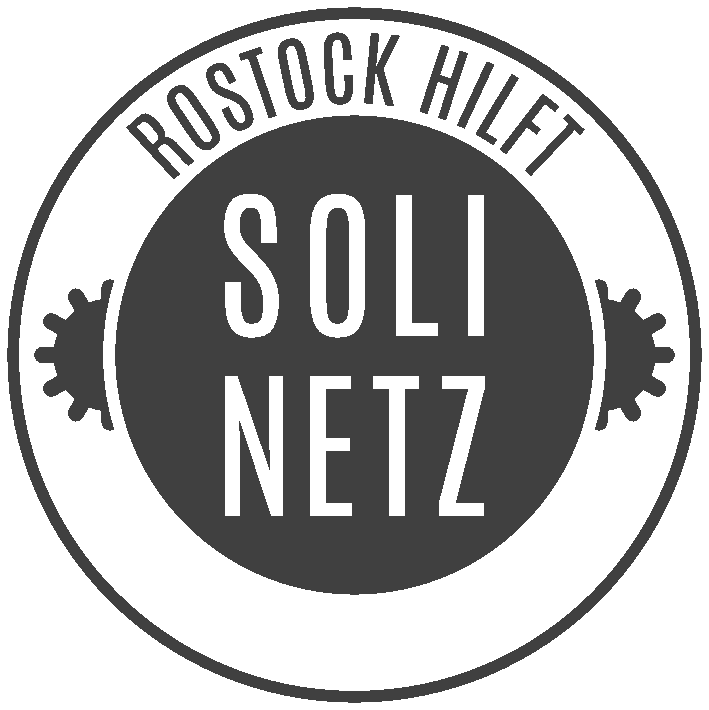Die Corona-Krise velangt uns allen viel ab. Doch muss man kein*e Sozialwissenschaftler*in sein, um in Zeiten des Ausnahmezustandes zu sehen, wen es dann doch mehr und wen es weniger trifft. Wie bereits im Debattenbeitrag #1 bzgl. der besonderen Betroffenheit marginalisierter Gruppen von Kontaktverboten und weiteren autoritären Versuchungen beschrieben wurde, gilt im Kontext von #StayAtHome und „ein bisschen Home-Office machen“ wie so oft: in erster Linie trifft es Frauen*. Es trifft sie in Gestalt der überwiegend weiblichen Beschäftigten im Gesundheits- und Pflegewesen. Es trifft sie in Gestalt der Niedriglohn-Bezieher*innen in den prekären Branchen ohne Arbeitnehmer*innenvertretung. Es trifft sie in Gestalt des Gender-Pay-Gap, der sich durch niedrigeres Kurzarbeiter*innen-Geld, niedrigeren ALG I und ALG II-Satz nach Jobverlust reproduziert. Es trifft sie in Gestalt einer Home-Office-Illusion, die suggeriert, als wenn man das, was man sonst im Büro oder der Firma erledigt, jetzt einfach nur vom Küchentisch aus erledigen könnte. Es trifft viele von ihnen in der jetzt zwangsweise zu organisierenden Frage der Betreuung von Angehörigen in Form von Babys, (Klein-) Kindern, schulpflichtigen Kindern, Jugendlichen und zu pflegenden Alten.
Und es trifft sie nicht nur ganz besonders, sondern ganz besonders hart, wenn diese Faktoren zusammenkommen. Wie sieht es für die Alleinerziehende mit einem 3-jährigen Kind aus, die jetzt ihre buchhalterische Lohnarbeit am Küchentisch in der Zwei-Zimmer-Wohnung erledigen soll? Wenn das Kind, neben eben jenem Tisch stehend, betreut werden will? Sie in ihrem Betrieb keine Interessenvertretung hat, die klarstellt, dass „Home-Office“ grundsätzlich auf Freiwilligkeit beruht, da der/die Arbeitgeber*in nicht über die private Wohnung der Beschäftigten verfügen kann und darf? Vielmehr dürfte Sie eine*n Chef*in haben, die/der ihr tief in die Augen blickt, an ihre „weiblichen Wesenszüge“ der devoten Empathie und Verständnisbereitschaft appelliert und durchblicken lässt, dass das mit dem Kind doch mal in den nächsten Tagen zu schaffen sei („Die Kollegin X hat mir schon mitgeteilt, dass das mit ihren zwei Kindern zu Hause gar kein Problem ist!“). Ob die Kollegin X vielleicht in einem Einfamilienhaus wohnt, ein eigenes Arbeitszimmer und zudem die Schwiegermutter als Kinderbetreuerin mit im Haus hat, ist natürlich irrelevant. Wichtig ist, dass jetzt alle an einem Strang ziehen!
Hier wird eine Schweinerei durchgesetzt, welche (bis jetzt) nur wenig öffentliche Empörung erregt. Die sowieso schon geringe Wertschätzung und gesellschaftliche Anerkennung für Betreuungs- und Pflegeaufgaben – kurz Sorgearbeit, auch Care-Work genannt – wird massiv ausgeweitet, indem dieser Aufgabenbereich noch weiter auf die individuelle Ebene, also jedes und jeder Einzelnen, wobei, doch eher jeder Einzelnen, verlagert wird. Oder sagen wir: vor die Füße geworfen wird. Mit der neoliberalen Illusion des „Just do it“ – Du musst es nur machen. Du musst es nur wollen.
Besondere Situationen, erfordern besondere Maßnahmen. Die Corona-Pandemie ist daher nicht nur eine besondere Situation der Virus-Verbreitung, sondern auch eine, in der sich die Missstände unserer Gesellschaft besonders deutlich und, für die jeweils Benachteiligten, in besonders harter Form zeigen. Es ist ebenso eine Situation, die uns als Gesellschaft zwingt, Zustände klar zu stellen. Dass wir endlich anerkennen, dass Sorgearbeit eben genau das ist: Arbeit, für die es Professionalität bedarf. Nicht umsonst gelten für Erzieher*innen, Pädagog*innen, Lehrer*innen, (Alten-)Pfleger*innen Ausbildungs- und Studiencurricula, Prüfungen und Abschlüsse. Für die es ebenso einer Entlohnung bedarf, die der gesellschaftlichen Bedeutung dieser Arbeit entspricht!
Und für die es in dieser besonderen Situation eine entsprechend besondere Lösung braucht. In Zeiten der sozialen Isolation, Schließung von Betreuungseinrichtungen und Schulen, verhindertem Kontakt zu Patient*innen und Klient*innen kann der Konsens zur Lösung der Corona-Krise und ihrer Nebenfolgen nicht die Auslagerung einer gesellschaftlichen Verantwortung auf wenige Einzelne sein, die zudem eh schon doppelten oder dreifachen Belastungen ausgesetzt sind.
Wir müssen jetzt – right here, right now – die Frage nach der sozialen Relevanz der Sorgearbeit stellen. Denn es bahnt sich an, dass die Corona-Krise nicht in zwei und auch nicht vier Wochen vorbei ist und wir unsere Kinder wieder in die Kitas und Schulen mit schlecht bezahlten, überarbeiteten Erzieher*innen und Lehrer*innen schicken können und sich damit die ganze Diskussion erledigt hätte. Wir können es nicht hinnehmen, wenn der jetzige Zustand in zwei Wochen wieder verlängert wird und wieder und wieder. Wenn wir dann erneut von unseren Chef*innen die Ansage zum Home-Office bekommen, ohne dass sie unsere familiäre Lage interessiert. Wenn wir uns dann wieder fragen müssen, wie man die Zeit von 6 Uhr morgens bis 19 Uhr abends mit einem 3-Jährigen in einer Zwei-Raum-Wohnung und einem kleinen Spaziergang mit Geheule vor dem abgesperrten Spielplatz rumkriegen soll, um dann abends nach „dem bisschen Sorgearbeit“ mit hängenden Schultern und kleinen Augen vor dem privaten 2009‘er Laptop ohne Office-Funktionen zu sitzen, um den von der/dem Chef*innen vorgegeben Planzahlen und Bearbeitungsfristen gerecht zu werden. Im besten Fall sind wir mit unser Rund-um-die Uhr-Arbeit ja so ausgelastet, dass wir uns gar nicht mehr fragen, wie das mit den Arbeitnehmer*innenrechten, maximalen Arbeitszeiten, Pausenzeiten, Urlaubstagen und dem Nicht-Zugriff des/ der Arbeitgeber*in auf das Private war.
Oder wir kehren das Mal-alle-kurz-die-Arschbacken-zusammen-kneifen um und schreiben unserer*m Chef*in von unserem Küchentisch aus per Mail: „Hey, danke, aber ich mache schon Sorgearbeit.“ Und vielleicht, ganz vielleicht könnten wir das gemeinsam tun, es als Frauen*streik abseits des 8. März tun und dafür sorgen, dass die Frage nach der gesellschaftlichen Relevanz der Sorgearbeit in der Corona-Krise gesellschaftlich und nicht individuell beantwortet wird.
Weiterführende Links: